Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Sialolithiasis – alles über die Steine in der Drüse
Was ist Sialolithiasis und wodurch wird sie verursacht?
Als Sialolithiasis wird eine Erkrankung bezeichnet, die durch kleine Steinchen in der Speicheldrüse ausgelöst wird. Als Ursache für die Entstehung von Speichelsteinen gelten
- ungesundes Essverhalten
- mangelnde Wasseraufnahme
- übermässiger Genussmittelkonsum
Eine starke Verschiebung des pH-Werts oder eine Erhöhung der Calciumkonzentration im Speichel können die Steinbildung fördern. Letztendlich kann die Steinbildung auch als Begleitsymptomatik anderer Erkrankungen auftreten: Insbesondere bakteriell ausgelöste Entzündungen der Speicheldrüsen als auch Erkrankungen der Nebenschilddrüse, wie der primäre Hyperparathyreoidismus, können eine erhöhte Calcium-Konzentration verursachen und somit für die Speichelsteinbildung förderlich sein.
Welche Symptome entstehen durch die Krankheit?
Auf Platz eins der charakteristischen Symptome einer Sialolithiasis stehen Schwellungen mit Schmerzen an den Speicheldrüsen. Diese werden von den Speichelsteinen besonders während der Speichelbildung, also vor und während der Nahrungsaufnahme, ausgelöst. Der Speichelstein verhindert während der Speichelbildung den Ausfluss des Speichels aus der Drüse, was zur erwähnten schmerzhaften Schwellung der Drüse führt. Folgerichtig könnte man bei Betroffenen eine andauernde Mundtrockenheit erwarten, diese ist jedoch nicht vorhanden, da im Regelfall nur eine der Speicheldrüsen betroffen ist. Bei einer anhaltenden Verstopfung kann eine Entzündung entstehen, durch die Eiter von der Drüse in die Mundhöhle gelangt. Wird diese Entzündung nicht behandelt, kann es auch zu einer Abszessbildung kommen.
Was bedeutet Sialolithiasis?
Die Wortzusammensetzung Sialolithiasis besteht aus den zwei altgriechischen Wörtern. Lithiasis kann am besten mit dem deutschen Wort „Steinleiden“ übersetzt werden und „sialon“ bezeichnet den Speichel. Wir kommen der Bezeichnung im Deutschen also am nächsten, wenn wir sie als „Speichelsteinleiden“ übersetzen. Neben der Sialolithiasis gibt es auch noch weitere Erkrankungen, die durch ein Steinleiden ausgelöst werden, beispielsweise die Harn- oder die Nierensteine. Diese Krankheiten werden ebenfalls mit dem Wort „Lithiasis“ gekennzeichnet. Für Harnsteine wird darum die Bezeichnung Urolithiasis und für Nierensteine die Bezeichnung Nephrolithiasis verwendet.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
 Zürich
ZürichZAHNARZTPRAXIS AM WEINBERG
PremiumWeinbergstrasse 62, 8006 ZürichZAHNARZTPRAXIS AM WEINBERG wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.9555 Bewetungen0434... Nummer anzeigen 043 443 42 42 -
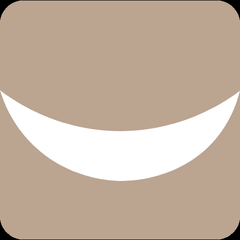 Dübendorf
DübendorfCITYDENTAL Stettbach - 365 Tage für Sie da
PremiumAm Stadtrand 5, 8600 DübendorfCITYDENTAL Stettbach - 365 Tage für Sie da wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet53 BewetungenJetzt geöffnet0442... Nummer anzeigen 044 215 51 51 *Jetzt geöffnet -
 Zürich
ZürichCITYDENTAL Oerlikon - 365 Tage für Sie da
PremiumHofwiesenstrasse 349, 8050 ZürichCITYDENTAL Oerlikon - 365 Tage für Sie da wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet51 Bewetungen0443... Nummer anzeigen 044 322 54 54
Welche Therapie bietet die Zahnmedizin an?
Die Stärke der Symptome ist letztendlich ausschlaggebend für das Behandlungsverfahren: Es können drei verschiedene Vorgehensweisen zum Einsatz kommen, die als konservative, minimalinvasive und operative Behandlungsmethoden bezeichnet werden:
- Die konservative Behandlung erfolgt im Anfangsstadium bei lediglich leichten Symptomen. Es wird hier lediglich oberflächlich mit leichten Medikamenten wie sauren Drops und einer vermehrten Flüssigkeitszufuhr gearbeitet. Natürlich können bei einsetzenden Entzündungen auch Antibiotika verabreicht werden. Die Behandlung ist hier zunächst abwartender Natur, da sich viele Speichelsteine auch durch leichte Therapien, wie Speicheldrüsenmassagen, lösen lassen.
- Kann über eine konservative Behandlung keine Verbesserung des Krankheitszustandes erzielt werden, so eignet sich die minimalinvasive Therapie für eine manuelle Entfernung der Speichelsteine. Hierfür können verschiedene Techniken angewandt werden: So lassen sich Speichelsteine durch Bohrer, Laser, Zangen und weitere Instrumentarien oftmals entfernen. Sehr gut für die minimalinvasive Entfernung von Speichelsteinen eignet sich auch die extrakorporale Stosswellenlithotripsie: Hierbei wird der Speichelstein durch gezielte Schallwellen von aussen zertrümmert. Die Kleinteile können anschliessend unproblematisch aus der Drüse entweichen.
- Wenn sowohl konservative als auch minimalinvasive Methoden der Zahnmedizin keinen Erfolg zeigen, hilft nur noch ein direkter, operativer Eingriff. Mittels eingeführter Sonde wird dann der Speichelstein exakt lokalisiert und über eine Gangschlitzung herausgenommen.
In welcher Speicheldrüse treten die Speichelsteine auf und welche Zusammensetzung haben sie?
Die Sialolithiasis tritt nicht in allen Kopfspeicheldrüsen gleich häufig auf. Die Lokalisation von Speichelsteinen findet am häufigsten in der Glandula Submandibularis statt. Prozentual betrachtet manifestiert sich die Erkrankung hier zu 83 Prozent, während sich Ohrspeicheldrüse und Unterzungendrüse die restlichen 17 Prozent der Speichelsteine teilen. Das unterschiedlich hohe Vorkommen an Speichelsteinen liegt an der unterschiedlichen Zusammensetzung des Speichels in den einzelnen Drüsen: Der Speichel der Glandula Submandibularis, oder einfacher „Unterkieferspeicheldrüse“, ist besonders reich an Calcium und Phosphat und begünstigt somit das Auftreten von Speichelsteinen. Darum kann die Zusammensetzung der Speichelsteine in den verschiedenen Speicheldrüsen auch sehr unterschiedlich sein. Es handelt sich um eine Mischung aus anorganischem Material, dass vorwiegend aus Calciumphosphat besteht und einer zentralen organischen Matrix aus Zelltrümmern, Glykoproteinen, Lipiden und vielem mehr. In der Unterkieferspeicheldrüse überwiegt aufgrund des hohen Calciumgehalts das anorganische Material, während die Zusammensetzung in der Ohrspeicheldrüse und Unterzungendrüse variieren kann.
Wie wird bei der Sialolithiasis eine Diagnose gestellt?
Die klinische Untersuchung kann schon die wichtigsten Hinweise für eine Sialolithiasis liefern. In Kombination mit einem einfachen bildgebenden Verfahren werden der Sonographie können so bereits 97 Prozent aller Speichelsteine identifiziert. Bei einer unklaren Diagnostik und anhaltenden Beschwerden kommen weitere bildgebende Verfahren wie die Kernspintomographie oder die Computertomographie für Untersuchungen zum Einsatz.
Welche Komplikationen können die Behandlungen verursachen?
Bei der Entfernung von Speichelsteinen kommt es nur selten zu Komplikationen. Insbesondere bei der operativen Gangschlitzung kann das zurückbleibende Narbengewebe die Speicheldrüse einengen. Sehr selten treten so starke Komplikationen bei der Speichelsteinentfernung auf, dass die gesamte Speicheldrüse entfernt werden muss. Die Entfernung einer Speicheldrüse kann wiederum Konsequenzen für die umgebenden Nerven haben, also Gefühls- und Geschmacksnerven beeinträchtigen.
Der Zahnarztvergleich für die Schweiz. Finde die besten Zahnärzte in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Zahnärzte
Das könnte dich auch interessieren
Eiterzahn rechtzeitig erkennen und behandeln
Viele Menschen erkennen ihn zu spät – dabei muss ein Eiterzahn dringend behandelt werden: Die Entzündung verursacht häufig nicht nur Zahnschmerzen, sondern führt auch dazu, dass die schädlichen Bakterien im schlimmsten Fall unsere Organe besiedeln. Dann kommt es zu ernsten Folgeerkrankungen, die sich nicht auf den Zahnapparat beschränken. Lies nach, wie du einen Eiterzahn erkennst und welche Behandlung hilft. Erfahre auch, was du am besten gegen akute Zahnschmerzen unternimmst und wie du einem Eiterzahn wirksam vorbeugst.
Zytostatika: Was sie können, wie man sie einsetzt und wie sie wirken
Zytostatika sind Arzneistoffe, die vor allem in der Behandlung von Krebs eingesetzt werden. Der Begriff ist von den griechischen Worten für Zelle (kytos) und anhalten (statikos) abgeleitet. Sie werden in diesem Zusammenhang meist unter dem Begriff Chemotherapie zusammengefasst. Ihre wachstumshemmende Wirkung, mit der sich das Wachstum von Krebszellen stoppen lässt, wurde während des Ersten Weltkriegs entdeckt. Danach wurde die Behandlungsmethode verfeinert und ist bis heute vielfach im Einsatz. Trotz der erfolgreichen Wirkung von Zytostatika müssen bei ihrer Verwendung aber auch die Nebenwirkungen beachtet werden. Diese stellen zum Beispiel die Zahnheilkunde vor Herausforderungen.
Kiefermuskulatur – Schluss mit Zähneknirschen, Verspannung und Schmerzen
Die Kiefermuskulatur übernimmt wichtige Aufgaben in deinem Körper. Ohne sie könntest du nicht wie gewohnt essen und das Sprechen würde dir schwerfallen. Viele Schweizer haben im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal Probleme mit der Kiefermuskulatur oder dem Kiefergelenk. Häufige Ursachen sind Stress, Zahnfehlstellungen und Verspannungen. Was du dagegen unternehmen kannst, verrät dieser Artikel.
Zahnschmelz – 7 Fragen und Antworten
Der Zahnschmelz auf den Zähnen besitzt eine wichtige Schutzfunktion und ist ein natürlicher Bestandteil der Zahnsubstanz. Nimmt der Schmelz ab, können ernsthafte Probleme und Erkrankungen an den Zähnen die Folge sein, von denen Karies nur die bekannteste ist. Der Abbau begünstigt auch Verfärbungen, Zahnstein oder empfindliche Zähne. Dabei kann schon falsches Zähneputzen oder eine zu säure- und zuckerhaltige Ernährung zu einem verstärkten Abrieb führen. Es ist entsprechend wichtig, den Zahnschmelz gesund zu erhalten und so Beschwerden wirksam vorzubeugen. Alles Wichtige zum Thema findest du hier.
Zahnbrücken: Infos, Tipps und Behandlung bei Zahnverlust
Eine Zahnlücke sieht nicht nur sehr unschön aus, sie kann auch zu Zahnfehlstellungen führen. Einen verlorenen Zahn zu ersetzen, ist daher unerlässlich. Eine mögliche Variante des Zahnersatzes bei Zahnverlust stellt die Zahnbrücke dar. Was Zahnbrücken sind und wie sich von Zahnkronen und Implantaten unterscheiden, erklären wir dir in diesem Ratgeber. Ausserdem erhältst du Infos zu den verschiedenen Arten von Zahnbrücken, zum Behandlungsablauf und zu möglichen Komplikationen.
Alles über die Infiltrationsanästhesie als eine Form der örtlichen Betäubung
Die Infiltrationsanästhesie ist eine Form der Lokalanästhesie. Sie spielt vor allem bei Zahnbehandlungen am Oberkiefer oder bei kleinen chirurgischen Eingriffen wie Wundversorgungen eine Rolle. Für zahnmedizinische Behandlungen am Unterkiefer ist dagegen oft eine Leitungsanästhesie nötig. Der folgende Artikel erklärt dir, welche Formen der Lokalanästhesie es gibt und was der Unterschied zwischen einer Infiltrations- und einer Leitungsanästhesie ist. Zudem erfährst du, welche Medikamente eingesetzt werden, wie sie wirken und welche Nebenwirkungen auftreten können.
